Multi-Kulti auf hohem Niveau?
Migranten und Integrationspolitik in Luxemburg
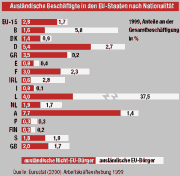
Ausländische Beschäftigte in den
EU-Staaten nach Nationalität
|

"Nationalgefühl und Identität?
... Darüber lächeln wir", sagt der luxemburgische Schriftsteller
Roger Manderscheid und erzählt in seinem Buch "Schwarze Engel"
von der schwarzen Isländerin, die bei der Iceland-Air in Luxemburg, dem
Zentralflughafen der Iceland-Air in Europa, als Stewardess arbeitet.
"Selbstbewusstsein haben wir nicht, wir haben nämlich keine Macht und
keine Waffen," so Manderscheid weiter. Zähigkeit und Widerstandskraft,
das seien die Eigenschaften der Luxemburger, die schon immer zwischen den
Kulturen lebten. Ein wenig untertrieben hat er da wohl schon. Kein Land in
Europa geht mit so viel Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit mit
der Zuwanderung und Integration von Ausländern um wie das kleine
Großherzogtum im Zentrum der Großregion Saar-Lor-Lux.
Ausländeranteile:
Gemischte Gesellschaft
Mit einem Ausländeranteil von über 35 %
(35,6 %) liegt Luxemburg mit Abstand an der Spitze der Mitgliedstaaten der
Union (vgl. Grafik). Bei einer Gesamteinwohnerzahl von rund 430.000 beläuft
sich die Zahl der ausländischen Wohnbevölkerung auf rund 153.000 (1999) -
und dies bei steigender Tendenz. Der größte Anteil hiervon entfällt
freilich auf EU-Ausländer (rund 90 %), in erster Linie Portugiesen (rund
53.900) und Italiener (20.000), Franzosen (17.500), Belgier (13.800) und
Deutsche (10.300)[1].
Angesichts der demografischen Entwicklung
und weiteren Zuwanderung ist der Zeitpunkt abzusehen, an dem die
Einheimischen eine Minderheit darstellen werden. Bezogen auf die Zahl der
Erwerbstätigen ist dies bereits geschehen. Rund 42 % der in Luxemburg
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer haben einen
ausländischen Pass. Zählt man die sonstigen Erwerbstätigen hinzu, so
liegt dieser Anteil bei über 50 %.
Bei einer Arbeitslosenquote von seit
Jahren um 3 %, einem nicht geringen Wirtschaftswachstum und einer wie in
Deutschland zunehmend vergreisenden einheimischen Bevölkerung stellen
ausländische Arbeitskräfte seit langem ein unverzichtbares Reservoir dar.
In den fünfziger Jahren bevorzugten die Stahlbarone des Landes Italien als
Anwerbeland, in den sechziger und siebziger Jahren wurden vor allem
Portugiesen für die Gastronomie, die Landwirtschaft sowie "einfache
Dienstleistungen" angeheuert, in den achtziger Jahren ebbte die
Anwerbung südeuropäischer Hilfsarbeiter ab. Es folgten Finanzfachleute aus
ganz Europa dem Lockruf des Geldes, vornehmlich Franzosen, Belgier und
Deutsche und schließlich zuletzt ein Heer von Eurokraten. Im Ergebnis
entstand eine äußerst heterogene Sozialstruktur, in der keiner im engeren
Sinn "arm" ist, aber doch große soziale Unterschiede bestehen.
Stille Mehrheit Eurokraten, Banker und
Grenzgänger
Neben der stillen Mehrheit der eher am
unteren Ende der Sozialskala stehenden Ausländer aus Südeuropa arbeiten
heute rund 7.000 Eurokraten aus den unterschiedlichsten EU-Mitgliedstaaten
in einer Reihe europäischer Institutionen auf dem Kirchberg-Plateau (so das
Generalsekretariat des Europäischen Parlaments, der Europäische
Gerichtshof, der Europäische Rechnungshof, Eurostat, das Amt für amtliche
Veröffentlichungen, die Europäische Investitionsbank u.a.). Hinzu kommen
zahlreiche Mitarbeiter ausländischer Bankinstitute, die einen zentralen
Wirtschaftsfaktor in der angeblichen Steueroase Luxemburgs darstellen.
Erwähnenswert sind nicht zuletzt die über 100.000 Grenzgänger aus
Deutschland (Raum Trier, Saarland), Lothringen und Wallonien, die täglich
zur Arbeitsaufnahme über die Grenze nach Luxemburg pendeln. Die so genannte
Großregion Saar-Lor-Lux ist damit die europäische Region mit der größten
Grenzgängermobilität überhaupt.
Pragmatische Integrationspolitik
Eine ausformulierte
"Integrationspolitik" oder gar eine kontroverse Debatte um
unterschiedliche Formen der Integration und/oder Assimilation gab es und
gibt es in Luxemburg nicht, dafür einen ausgesprochenen Pragmatismus.
Erleichtert wird dabei die Integration von Ausländern zweifellos durch die
Vielsprachigkeit im Land, in dem praktisch jeder fließend drei Sprachen
spricht. Bewusst, so ein Regierungsvertreter, betreibe man keine aggressive
Politik der Assimilierung, sondern setzt auf Integration im Sinne einer
gegenseitigen Durchmischung der Kulturen. Vertreter ausländischer Gruppen
wittern freilich hinter dem Bekenntnis zur multikulturellen Vielfalt eher
Gleichgültigkeit. Betroffen hiervon seien dabei nicht die Grenzgänger,
Eurokraten und sonstigen Hochqualifizierten, sondern die in letztlich
ärmlichen Verhältnissen lebenden Immigranten aus Südeuropa. Die hohen
Abbrecherquoten an den Schulen und die Mühe, die die Kinder der Immigranten
hätten, sich in dem mehrsprachigen Schulsystem zurechtzufinden, seien, so
Kritiker, ein Indiz dafür, dass auch im Wirtschaftswunderland Luxemburg die
Integration nicht reibungslos verläuft.
Euro-Nachwuchs für die Armee
Luxemburgs
Ein geradezu klassisches Beispiel für die
pragmatische Ausländerpolitik Luxemburgs und absolut undenkbar in anderen
EU-Staaten ist die für 2002 geplante Aufstockung der Armee des
Nato-Mitglieds Luxemburg durch die Anwerbung von EU-Ausländern. 1.131
Soldaten ist laut Gesetz die Sollstärke der luxemburgischen Armee. Weil
diese aus der einheimischen Bevölkerung Luxemburgs selbst nicht rekrutiert
werden können, sollen nun Deutsche, Franzosen, Spanier oder andere
angeworben werden. Einzige Voraussetzung: Die Bewerber müssen mindestens
ein Jahr im Großherzogtum leben und von den drei Amtssprachen Deutsch und
Französisch beherrschen und Lëtzebuerger Platt verstehen. Wer will,
bekommt Nachhilfeunterricht. Nach fünf Jahren in Uniform können die
"europäischen Söldner" luxemburgische Staatsbürger werden und
in den Staatsdienst wechseln. Pragmatismus pur, zur Nachahmung empfohlen. |
![]() Ausländer in Deutschland
4/2001, 17.Jg., 15. Dezember 2001
Ausländer in Deutschland
4/2001, 17.Jg., 15. Dezember 2001