![]() Ausländer in Deutschland
2/2002, 18.Jg., 30. Juni 2002
Ausländer in Deutschland
2/2002, 18.Jg., 30. Juni 2002
ZUWANDERUNGSGESETZ |
|||
Hochqualifizierte, Kinder und FlüchtlingeDie neuen Zuwanderungs- regelungen im Überblick
|
Die folgende Übersicht über die neuen Regelungen des Zuwanderungsgesetzes basiert im Wesentlichen auf Angaben des Bundesministeriums des Inneren. [1] ArbeitsmigrationIm Bereich der Arbeitsmigration wird eine genauere Steuerung entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ermöglicht: Das Regelverfahren des Arbeitsmarktzugangs wird flexibilisiert und die Steuerungsmöglichkeiten der Arbeitsverwaltung - das heißt der Bundesanstalt für Arbeit (BA) - werden erhöht. Die Vorrangprüfung durch die Arbeitsverwaltung wird vereinfacht und den Verwaltungsausschüssen der Arbeitsämter werden mehr Kompetenzen eingeräumt. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist auch künftig nur möglich, wenn für eine Stelle bundesweit weder deutsche noch bevorrechtigte ausländische Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Das bisherige doppelte Genehmigungsverfahren (Arbeit/Aufenthalt) wird durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt. Die Arbeitsgenehmigung wird in einem Akt mit der Aufenthaltserlaubnis erteilt, sofern die Arbeitsverwaltung intern zugestimmt hat. Der Aufenthaltstitel wird von der Ausländerbehörde erteilt. Dem Betroffenen werden damit mehrere Anträge und Behördengänge erspart (so genanntes "one-stop-government"). Für Hochqualifizierte (wie zum Beispiel Ingenieure, Informatiker, Mathematiker sowie Führungspersonal in Wissenschaft und Forschung) wird die Möglichkeit der Gewährung eines Daueraufenthalts von Anfang an vorgesehen. Ergänzend werden die Voraussetzungen geschaffen, im Bedarfsfall eine begrenzte Zahl besonders geeigneter Zuwanderer über ein Auswahlverfahren aufzunehmen. Es handelt sich dabei um ein zusätzliches optionales Steuerungsinstrument, das voraussichtlich zunächst nur einer sehr begrenzten Anzahl von Zuwanderern offen stehen wird. Voraussetzung ist die sorgfältige Auswahl der Bewerber. Mindestbedingungen sind eine Berufsausbildung und die Möglichkeit der Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Zusätzliche Kriterien sind: Alter, Qualifikation, Sprachkenntnisse, Beziehungen zu Deutschland sowie das Herkunftsland. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Staatsangehörige aus EU - Beitrittskandidaten besonders zu berücksichtigen. Das Auswahlverfahren wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchgeführt. Voraussetzung dafür ist, dass das BAMF und die BA nach Beteiligung des Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration bereits eine Höchstzahl für die Zuwanderung im Auswahlverfahren festgesetzt haben. |
||
|
|
Studienabsolventen und SelbständigeAusländischen Studienabsolventen wird die Arbeitsaufnahme nach Zustimmung der Arbeitsverwaltung ermöglicht. Darüber hinaus können sie eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr erhalten, um sich einen Arbeitsplatz in Deutschland zu suchen. Es soll verhindert werden, dass in Deutschland gut ausgebildete Fachkräfte, die dringend benötigt werden, in andere Industrieländer abwandern. Bislang müssen sie Deutschland nach ihrem Studienabschluss verlassen. Für die Zuwanderung von Selbständigen, die positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung erwarten lassen, wird eine rechtliche Grundlage geschaffen. Voraussetzung ist, dass ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales Bedürfnis besteht. |
||
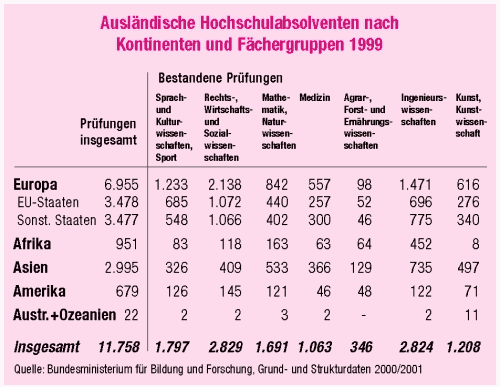
|
|||
|
|
FamiliennachzugHochqualifizierten mit einer Niederlassungserlaubnis wird der Kindernachzug bis zu einem Alter von 18 Jahren ermöglicht. Generell ist ein Anspruch auf Nachzug von Kindern bis zum 18. Lebensjahr bei Einreise im Familienverband vorgesehen. Bei der Einreise außerhalb des Familienverbands besteht ein Nachzugsanspruch bis zum 12. Lebensjahr. Darüber hinaus ist ein Nachzug nach Ermessen möglich, wenn das Kindeswohl oder die familiäre Situation es erfordern und, beispielsweise wegen vorhandener Deutschkenntnisse, zu erwarten ist, dass das Kind sich in Deutschland integriert. Hinter dieser Differenzierung steht das Ziel, eine möglichst frühzeitige Integration der Kinder sicherzustellen. Die Praxis, Kinder außerhalb der Familie im Herkunftsland aufwachsen zu lassen und sie kurz vor Ablauf des regulären Nachzugsalters (zur Zeit 16 Jahre) nach Deutschland zu holen, soll damit erschwert werden. Nachziehende Familienangehörige sollen künftig die gleiche Möglichkeit des Arbeitszugangs haben, wie die Person zu der sie nachziehen. Bislang wird nachziehenden Familienangehörigen erst nach einem Jahr Wartezeit ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang eingeräumt. |
||
|
|
AsylverfahrenDie aufenthaltsrechtliche Stellung von Inhabern des sog. "kleinen Asyls" wird der von Asylberechtigten angeglichen. Beide Gruppen erhalten zunächst einen befristeten Aufenthaltstitel, der nach drei Jahren zu einer Verfestigung führen kann, wenn die Voraussetzungen weiterhin bestehen. Inhaber des "kleinen Asyls" erhalten - wie bislang nur die Asylberechtigten - ungehinderten Arbeitsmarktzugang. Bei Asylberechtigten und Inhabern des sog. "kleinen Asyls" wird vor Erteilung eines Daueraufenthaltsrechts nach 3 Jahren überprüft, ob sich die Verhältnisse im Herkunftsland geändert haben. Diese Überprüfung soll generell auf der Grundlage der Lageberichte des Auswärtigen Amtes durchgeführt werden. Bereits nach geltendem Recht ist die Anerkennung als Asylberechtigter unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr vorliegen. Es ist daher folgerichtig, zumindest vor der Gewährung eines Daueraufenthaltsrechts eine Überprüfung vorzunehmen.
Die Weisungsunabhängigkeit der Einzelentscheider und das Amt des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten sollen abgeschafft werden. Dies soll zur Beschleunigung der Verfahren und zu einer Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis führen. Antragsteller, die zwar bei Grenzbehörden oder bei Ausländerbehörden ein Asylgesuch stellen, danach aber untertauchen und keinen förmlichen Asylantrag stellen und damit den Beginn ihres Asylverfahrens verzögern, werden künftig in das Asylfolgeverfahren verwiesen. Künftig wird auch kein sogenanntes "kleine Asyl" mehr gewährt, wenn der Ausländer ohne Verfolgungshintergrund aus seinem Herkunftsland ausreist und erst durch selbstgeschaffene (subjektive) Nachfluchtgründe eine Verfolgung im Herkunftsland auslöst. Das erstinstanzliche Gerichtsverfahren soll künftig zwingend durch einen Einzelrichter durchgeführt werden. Ein Wechsel vom Asylverfahren in die Zuwanderung aus Erwerbsgründen wird ausgeschlossen. Hierauf werden die Asylantragsteller hingewiesen. Humanitäre Aufnahme, Ausreisepflicht und RückführungDie bisherige Regelung von humanitären "Bleiberechten" hat nach Auffassung der Bundesregierung in der Vergangenheit häufig zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt. Die Betroffenen wurden in einem aufenthaltsrechtlichen Schwebezustand belassen, unabhängig davon, ob sie bestehende Rückkehrhindernisse zu vertreten hatten oder nicht. In der Regel wurde eine so genannte "Duldung" (Aussetzung der Abschiebung) ausgesprochen, die aber kein Aufenthaltsrecht begründete. Eingesetzt wurde sie bislang häufig als "zweitklassiger Aufenthaltstitel". Zur Zeit gibt es knapp 250.000 "Geduldete", fast einem Viertel von ihnen wurde die Duldung bereits 1997 oder früher erteilt. Nun wird die Duldung abgeschafft. Die Neuregelung differenziert jetzt zwischen Personen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, sowie solchen, die nicht zurückkehren wollen. Personen, die aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben nicht zurückkehren können, soll ein befristetes Aufenthaltsrecht gewährt werden. Dabei wird insbesondere der Aufenthaltsstatus von Opfern nichtstaatlicher oder geschlechtsspezifischer Verfolgung verbessert. Sie können nun den Status eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten, wenn deren Voraussetzungen erfüllt sind. Die Rückführung von Personen, die mit Absicht versuchen, sich ihrer Ausreisepflicht zu entziehen, soll künftig strikter durchgesetzt werden. Die Gewährung eines Aufenthaltstitels soll nicht mehr in Betracht kommen, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder wenn die Person die Ausreisehindernisse selbst zu vertreten hat (beispielsweise durch Verschleierung von Identität oder Staatsangehörigkeit). Humanitär besonders problematischen Einzelfällen kann dadurch Rechnung getragen werden, dass auf Ersuchen einer von der Landesregierung bestimmten Stelle (zum Beispiel einer Härtefallkommission) ein Aufenthaltsrecht gewährt werden kann. Auf Ihrer Frühjahrskonferenz in Mainz am 17./18. April 2002 haben sich die Ausländerbeauftragten der Länder für die Einrichtung von Härtefallkommissionen ausgesprochen, um die Härtefallregelung mit Leben zu erfüllen. Die Differenzierung zwischen Personen, die nicht zurückkehren können, und solchen die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen, soll ein zielgerichtetes und effizienteres Vorgehen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht ermöglichen. Ausreisepflichtige Personen sollen nicht besser gestellt werden als Asylbewerber. Vorgesehen ist, ihren Aufenthalt räumlich zu beschränken. Es soll auch möglich werden, die betroffenen Personen zu verpflichten, in einer Ausreiseeinrichtung zu wohnen. So wird dies bereits in einigen Bundesländern praktiziert. Ziel ist es, die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise zu fördern und die Beschaffung von Heimreisedokumenten zu beschleunigen. Wenn Angehörige einzelner so genannter Problemstaaten ein Visum beantragen, sollen von ihnen künftig Fotos und Fingerabdrücke angefertigt werden können, damit die sichere Feststellung ihrer Identität gewährleistet ist. Darüber hinaus wird künftig bestraft werden können, wer falsche Angaben über seine Identität oder Staatsangehörigkeit macht. |
||
|
IntegrationIm Aufenthaltsgesetz ist ein Mindestrahmen staatlicher Integrationsangebote (Sprachkurse, Einführungen in die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte Deutschlands) vorgesehen. Ausländer, die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten, erhalten einen Anspruch auf die Teilnahme an Integrationskursen. Bei fehlenden Deutschkenntnissen besteht eine Teilnahmepflicht. Wenn die betreffende Person der Pflicht nicht nachkommt, wird die zuständige Ausländerbehörde mit ihm ein Beratungsgespräch führen. Die Nichtteilnahme wird künftig bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt. Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache sowie Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet sind auch Voraussetzung für die Gewährung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts (Niederlassungserlaubnis). Darüber hinaus ermöglicht die erfolgreiche Kursteilnahme auch eine Fristverkürzung bei der Einbürgerung von 8 auf 7 Jahre. Das Bundesministerium des Innern wird in Abstimmung mit den Ländern, den Kommunen, den Ausländerbeauftragten und den gesellschaftlichen Gruppen ein bundesweites Integrationsprogramm entwickeln, in dem insbesondere die bestehenden Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommunen und privaten Trägern festgestellt und Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung gegeben werden. Unionsbürger und EU-HarmonisierungAufgrund der Niederlassungsfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union (EU) wird die Notwendigkeit einer Aufenthaltserlaubnis für UnionsbürgerInnen abgeschafft. Zukünftig besteht nur noch eine Meldepflicht bei den Meldebehörden. Sie erhalten eine Bescheinigung ihres Aufenthaltsrechts. Die EU - Richtlinien zur Gewährung von vorübergehendem Schutz und zur Anerkennung von Rückführungsentscheidungen anderer Mitgliedsstaaten sind in das neue Aufenthaltsgesetz eingearbeitet worden. |
||
[1] "Entwurf des Zuwanderungsgesetzes: Übersicht wichtiger Änderungen gegenüber dem geltenden Recht", Artikel der Internetredaktion des Bundesministeriums des Inneren, veröffentlicht am 25. März 2002. Autor: Ekkehart Schmidt-Fink, isoplan |
|||
[ Seitenanfang ] |
|||
Kommunen fordern Kostenübernahme |
Berlin. Gegenüber Bundesinnenminister Otto Schily haben Vertreter der kommunalen Spitzenverbände am 19. März 2002 erklärt, dass sie das Zuwanderungsgesetz für unverzichtbar halten. Die Städte und Gemeinden erwarten insbesondere, dass die Integrationsleistungen für Neuzuwanderer und bereits hier lebende Migranten erhöht würden. Insoweit zeige der Gesetzesentwurf gute Ansätze. Es werde allerdings nötig sein, zeitnah die Integrationsanstrengungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu erhöhen. Derzeit trügen die Gemeinden die Hauptlast der Integration. Schily wies darauf hin, dass mit dem Gesetz erstmals eine rechtliche Verpflichtung des Bundes zur Übernahme von Integrationskosten geschaffen werde. Der Bund werde sowohl bei den Neuzuwandern als auch bei den bereits hier lebenden Ausländern zwei Drittel der Integrationskosten - künftig rund 675 Millionen EUR pro Jahr - übernehmen. (esf) |
||
[ Seitenanfang ] |
|||
Stellungnahmen des Bundesausländer- beirates |
Der Bundesausländerbeirat vertritt 13 Landes- und über 400 Lokalorganisationen. In zwei Stellungnahmen hat sich dessen Vorsitzender, Memet Kilic, zur Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes im Bundestag (1. März 2002) und im Bundesrat (22. März 2002) geäussert. Wir dokumentieren beide in gekürzter Form. 1. März 2002: "Aus Sicht der Migranten gibt es keinen Grund zur Euphorie, dass das Zuwanderungsgesetz heute im Bundestag verabschiedet worden ist. Die Verschlechterungen und Verbesserungen des Ausländergesetzes halten sich die Waage. Vielmehr darf sich die Wirtschaft darüber freuen, daß diese Arbeitskräfte aus dem Ausland je nach Bedarf hereinholen kann. Dieses Gesetz betrachtet die Migranten nach wie vor als unerwünschte Last und Gefahr, die in Ausnahmefällen in Kauf genommen werden muß. Diese Haltung trägt zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas gegenüber Migranten nichts bei. Jedoch ist der Bundesausländerbeirat als Interessenvertretung der Migranten verpflichtet, ein Gesetz nicht nur inhaltlich ... sondern auch mit Blick auf die gesellschaftlichen Nachwirkungen zu bewerten. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verabschiedung des Gesetzes auch im Bundesrat. Eine Verhinderung des Gesetzes ...wird weder den Interessen der Bundesrepublik noch den Migranten dienen, weil das gesellschaftliche Klima auch dadurch nicht besser wird. (...) Dieses Gesetz berücksichtigt Hauptwünsche der Unionsparteien. Deshalb wäre es nicht verantwortlich, wenn die Unionsparteien aus ideologischen Gründen versuchen würden, dieses Gesetz im Bundesrat zum Scheitern zu bringen (...)" 22. März 2002: "Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes wurden einige wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen, die für die Zukunft unserer Gesellschaft von essentieller Bedeutung sind: Mit der Lebenslüge, Deutschland sei kein Einwanderungsland, ist auch rechtlich Schluss. Es wurde endlich erkannt, dass die Integration sich nicht als Forderung allein an die Migranten richtet, sondern vielmehr eine staatliche Aufgabe ist. Immerhin wurde mit den Übergangsregelungen (§ 99 und 102) sichergestellt, daß die bereits in Deutschland lebenden Migranten von den erhöhten Anforderungen weitgehend ausgenommen werden. Auch die allgemeine Härtefallregelung gibt den Ländern die Möglichkeit, in besonderen Fällen humanitäre Lösungen zu finden. (...) Als Jurist vertrete auch ich die Meinung, daß das Gesetz verfassungskonform und somit wirksam verabschiedet wurde. (...)" |
||
[ Seitenanfang ] [ Nächste Seite ] [ Vorherige Seite ] |
|||
© isoplan-Saarbrücken. Nachdruck und Vervielfältigung unter Nennung der Quelle gestattet (bitte Belegexemplar zusenden). Technischer Hinweis: Falls Sie diese Seite ohne das Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite sehen, klicken Sie bitte HIER und wählen Sie danach die Seite ggf. erneut aus dem entsprechenden Inhaltsverzeichnis. |
|||